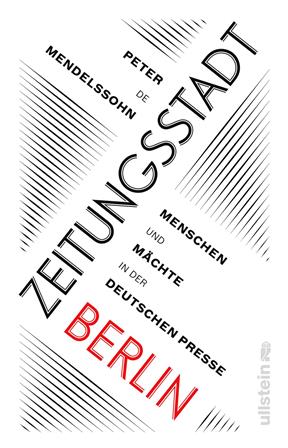In einer Zeit, in der die Abgesänge auf das Zeitalter der Zeitung sich häufen, scheint dieses Projekt sympathisch aus der Zeit gefallen: Ein 800-seitiges Standardwerk zur Zeitungsstadt Berlin , verfasst von Peter de Mendelssohn (1908-1982) und zu dessen Lebzeiten in zwei Auflagen (1959 und 1982) erschienen, wurde jetzt posthum für eine dritte Auflage fortgeschrieben. Mit Lutz Hachmeister , Leif Kramp und Stephan Weichert besorgten drei namhafte Medienwissenschafler die knapp hundertseitige Erweiterung bis in die Gegenwart, die neben der Figur Peter de Mendelssohn die Ära nach Axel Springer, die Zeit der Wiedervereinigung und des Regierungsumzugs in die reaktivierte deutsche Hauptstadt sowie die jüngeren Bewegungen auf dem Berliner Zeitungs- und Medienmarkt in den Blick nimmt.
Bevor uns die eigentliche Fortschreibung interessiert, sollten wir die Gelegenheit ergreifen, noch einmal zu rekapitulieren, wer Peter de Mendelssohn war und was seine Pressehistorie zum Standardwerk gemacht hat. Der deutsch-britische Publizist, Literat und Biograf (u.a. von Winston Churchill und Thomas Mann) erlebt in den letzten Jahren von verschiedener Seite eine Renaissance: So befasst sich Marcus Payk in seiner beachtenswerten Studie zum publizistisch-intellektuellen Feld der frühen Bundesrepublik mit Mendelssohn, und sein 2002 wiederaufgelegter Roman Fertig mit Berlin? (die Originalausgabe erschien 1930 bei Reclam ) gilt Hachmeister/Kramp/Weichert als „pointilistischer“ Einblick in das Pressemilieu der Weimarer Republik, ein Zeugnis ähnlich effektvoller Zeitgenossenschaft wie Gabriele Tergits Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm .
Dass der Herausgeberkreis Deutsches Pressemuseum im Ullsteinhaus e.V. (DPMU) – der übrigens eine empfehlenswerte Online-Dokumentation zum Berliner Zeitungsviertel betreibt – sich seinerseits für die Mendelssohn-Neuauflage engagiert hat, korrespondiert auch mit einem Jubiläum: 2017 wird die Zeitungsstadt Berlin 400 Jahre alt. 1617, also gerade einmal hundert Jahre nach der Reformation, erschien an der Spree die erste regelmäßige Publikation in Zeitungsform, die so genannte „Frischmann-Zeitung“.
Man kann spekulieren, was von dieser stolzen Historie bleibt in einer Zeit, in der Berlin, wie Hachmeister/Kramp/Weichert betonen, das Schicksal einer „Zeitungsstadt ohne Zeitungen“ droht: Längst erwirtschaftet die Axel Springer SE, zwischen 1945 und 1989 immerhin ein Beinahe-Monopolist auf dem West-Berliner Zeitungsmarkt, das Gros ihrer Umsätze digital – und zum geringsten Anteil mit Journalismus. Längst zählt die deutsche Hauptstadt, was Arbeitsplätze angeht, mehr PR-Stellen und Social-Media-Beauftragte bei Lobbyverbänden als klassische Journalisten. Allein 600 Angestellte sind bei der Bertelsmann-Firma Arvato damit beschäftigt, im Auftrag von Facebook Hasskommentare und andere unerwünschte Inhalte zu löschen. Kurzum: Belegschaften in Größenordnungen, mit denen einstmals komplette Regionalzeitungen (Verlag und Redaktion) geführt wurden, machen in Berlin heute was mit Medien.
Die Zeitungsstadt Berlin
Ausgehend vom geflügelten Wort des Blätterwaldes möchte Mendelssohn mit seiner Zeitungsstadt Berlin weder die Geschichte eines einzelnen Blattes noch die des ganzen Waldes schreiben, sondern die eines großen Baumes bzw. einer „Baumgruppe“. Die Zeit des Zweiten Weltkriegs, als auf die nationalsozialistische Gleichschaltungspolitik auch noch eine Stilllegungsphase (wegen Papiermangels) folgte, setzt Mendelssohn entsprechend ins Bild: „Der ganze riesige Blätterwald schrumpft zu einem einzigen Baum zusammen, und diesen Baum trifft der Blitz.“
Mendelssohns Monografie deklariert sich selbst als „Biographie eines einzigartigen und erstaunlichen Lebewesens“. Das Buch verspricht „vielfältige und abenteuerliche Schicksale“ der Zeitungsstadt Berlin „als eine fortlaufende und zusammenhängende Lebensgeschichte zu erzählen“ (S. 15). Die Jahrhunderte vom Beginn des Dreißigjährigen Krieges bis zur Revolution von 1848 (inklusive Vossischer Zeitung und Kleists Berliner Abendblättern ) handelt Mendelssohn auf kaum 100 Seiten ab. Seine ganze Aufmerksamkeit strebt den drei Gründerfiguren entgegen, die den Zeitungsplatz Berlin im ausgehenden 19. Jahrhundert und für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts erheblich prägen sollten: Leopold Ullstein, Rudolf Mosse und August Scherl.
Mendelssohns Zugriff ist, vom Standpunkt heutiger Medienwissenschaft gesprochen, kommunikatorbezogen. Man muss einräumen, dass es ihm mit Blick auf den Ullstein-Mosse-Scherl-Komplex tatsächlich gelingt, was der Untertitel verspricht: „Menschen und Mächte“ zu erzählen. Hier liefert er soziologische und ethnografische Beobachtungen, die trotz ihrer terminologisch naiven Form anschlussfähig für feld- oder systemtheorische Betrachtungen (Bourdieu/Luhmann) sind.
Die Jahrzehnte von der deutschen Reichsgründung 1871 bis zum Ende der Weimarer Republik 1933 bilden in Mendelssohns Pressehistoriografie auch deshalb den Höhe- und Fluchtpunkt, weil die Zeitungsstadt Berlin hier eine konkurrierende Vielfalt und gewerbliche Dynamik entfaltet, die ihresgleichen sucht: Berlins „Aufstieg als Stadt ging Hand in Hand mit dem der Zeitung“ und liefert Mendelssohn das Meisternarrativ. Sein Fokus richtet sich nicht zuletzt auf die drucktechnologischen Voraussetzungen für eine echte Massenpresse. Einerseits waren Errungenschaften wie die Autotypie und die Momentfotografie entscheidend dafür, dass sich der Typus der Illustrierten in Form der äußerst erfolgreichen Berliner Illustrirten Zeitung (gegründet 1890 und ab 1894 bei Ullstein ) herausbilden konnte, verbunden mit dem neuen Beruf des Bildreporters. Andererseits waren für die dynamische Entwicklung des Zeitungsmarktes auch vertriebliche Belange vonnöten: Erst der Verkauf nicht nur im Buchhandel, sondern auch an S-Bahn-Stationen und später sogar auf der Straße macht den Typus der Straßenverkaufs-/Boulevardzeitung historisch möglich.
Die Schnelligkeit des 1904 gegründeten Boulevardblatts B.Z. am Mittag erscheint– selbst noch nach heutigen Online-Maßstäben – bestechend: „Als am 17. Oktober 1913 um elf Uhr vormittags in Johannisthal ein Zeppelin-Luftschiff tragisch verunglückte, war die B.Z. am Mittag bereits eine Stunde später mit einem ausführlichen Bericht über das Unglück in den Händen ihrer Leser.“ (S. 234) Dieser rapide Workflow im Hause Ullstein übertrifft manches Online-Medium noch heute.
Interessant auch, wie die Haltung, mit der man weiland die B.Z. in der Mittagspause konsumierte, der heutigen Nutzung von „Spiegel Online“ und vergleichbaren Portalen im Büroalltag nahekommt: „ein wenig abgelenkt, unterhalten und amüsiert“ (S. 231). Gerade mit solchen Aha-Momenten lohnt sich die Lektüre der Zeitungsstadt Berlin für den Leser mit Langzeitsperspektive bis heute. Offensichtlich haben sich die Endgeräte für Medienkonsum überlebt, nicht aber gewisse überzeitliche Medienfunktionen.
Anschaulich bringt einem Mendelssohns Pressegeschichte auch Phänomene wie die zwischenzeitlich bis zu dreimal täglich erscheinenden Tageszeitungen nahe. Diese hohe Frequenz war nicht nur der Aktualität, sondern auch der Auslastung der mit enormen Investitionen verbundenen Druckmaschinen der Verlage geschuldet. Profane medienökonomische Kalkulationen und publizistische Innovationen gehen im Unternehmen Zeitung oft im Gleichschritt einher.
Überhaupt macht sich Mendelssohn die (unter journalistischen Praktikern verbreitete) Haltung zu eigen, wonach Zeitungen und Medien am besten privatwirtschaftlich-gewerbliche Unternehmungen sind, die einen verlegerischen Kompass und kaufmännisches Geschick verlangen, aber möglichst keine Weltanschauung und ideologiegeleiteten Investoren. „Die Industriellen haben kein Talent für die Presse.“ [1] Hier meint Mendelssohn den „Pressemagnaten“, der auch und nicht zuletzt politische Ambitionen mit in die Meinungsfabriken einbringt (S. 336). Dieser Typus Investor tritt in der Berliner Pressegeschichte mit Alfred Hugenberg ab 1913 auf den Plan. Anschaulich rekapituliert Mendelssohn Hugenbergs ungutes Engagement im Scherl-Konzern und beschreibt sein Fort- und Einwirken im Sinne eines deutsch-nationalen bzw. alldeutschen Weltbildes, das schließlich in den Untergang der Weimarer Republik durch den Nationalsozialismus führt: „Hugenberg bestellte das Feld. Hitler erntete es ab.“ (S. 392). Ausführlich analysiert Mendelssohn auch die Umstände für das Versagen einer demokratischen Presse, die in Sachen Vielfalt ja nicht unterentwickelt war. Allein: „Die Zeitungen konnten die Republik nicht populärer machen, als die Republik sein wollte“ (S. 434). Mendelsohns gründliche Darstellung der Art und Weise, wie die Gleichschaltung wirtschaftlich vorbereitet wurde und organisationell vonstatten ging, gehört zu den luzidesten Abschnitten seiner Pressegeschichte. [2]
Anregungen für die Feuilletonforschung
Für den Feuilletonforscher liefert Mendelssohns Standardwerk bis heute Hinweise auf Desiderate, auf die hier nur kursorisch verwiesen werden soll: Was etwa hat es mit der von der B.Z. am Mittag kultivierten Kürze auf sich, die Mendelssohn als „aphoristische“ Kritik bezeichnet – in Abgrenzung zur traditionellen „essayistischen Kritik“ (S. 236)? Inwieweit bilden die von Mendelssohn genannten Vertreter (Norbert Falk, Paul Wiegeler) eine generische Tradition aus, von der sich Linien bis zum „Kurzessay“ ziehen lassen – einer Kategorie, die jüngst Eike Rautenstrauch in die Diskussion eingebracht hat, und zwar als alternative Bezeichnung für die Kleine Form, die Rautenstrauch nicht länger mit dem Gattungsbegriff Feuilleton belegt wissen will?
Mit Blick auf die Zeit vor 1848 wäre die Frage zu vertiefen, ob die „gelehrten Sachen“ in der „Tante Voss“ und im „Onkel Spener“, also in der Vossischen Zeitung und der Spenerschen Zeitung , tatsächlich proportional zur drückenden politischen Zensur zunehmen (vgl. S. 70). Interessant erscheint an gleicher Stelle auch der Hinweis, dass Iffland in seiner Funktion als Schauspieldirektor zu Berlin beim Staatskanzler Hardenberg offenbar die Verfügung erwirkt hatte, dass Tadel (später auch Lob) zu Theateraufführungen erst nach der dritten Vorstellung veröffentlicht werden durfte.
Mit Blick auf die überregionale Anziehungskraft von Berlin (vgl. Tucholsky : „Der richtige Berliner ist meist aus Posen oder aus Breslau“) wäre der vertiefende Blick auf Herkunftsorte von in Berlin wirkenden Feuilletonisten interessant. Namen wie Arthur Bremer, den uns Mendelssohn als Gründungschefredakteur der Berliner Morgenpost vorstellt (S. 191 und 197 f.) oder Hermann Bachmann aus dem Egerland, der zum 200-Jahr-Jubiläum 1904 der Vossischen Zeitung vorstand (S. 248), wären als k.u.k.-Input für das reichsdeutsch-journalistische Feld zu beleuchten – und könnten bekannte Figuren wie Kisch, Haas, Roth und Stefan Grossmann ergänzen. Ohnehin kann man die Zeitungsstadt Berlin nur einmal mehr als Einladung lesen, das Feuilleton nicht immer notorisch als Galerie herausragender Autoren (Feuilletonisten), sondern auch als Geschichte seiner Blattmacher zu begreifen (Bettina Brauns Forschung zu Otto Kleiber kann in dieser Beziehung als echtes Vorbild gelten). Nun aber zur abschließenden Frage: Was leistet die Fortschreibung des Werks bis in die Gegenwart?
Das Update der Zeitungsstadt Berlin
Rein äußerlich hat das Buch durch den erweiterten Umfang nicht nur an Gewicht zugelegt; es hat gegenüber der Vorgängerauflage auch seine Gestalt veredelt. Formschön geraten ist die Typographie auf dem Schutzumschlag – in einer Anordnung, die abstrahiert an Stapelware und Transportketten im Druckereiwesen denken lässt.
Nicht mehr zeitgemäß für ein Standardwerk dieser Kategorie war, dass Mendelssohn seine quellenreiche Pressegeschichte gänzlich ohne Belege verfasst hatte; dies haben die Neuherausgeber nun nachgeholt. Ebenso haben sie den bibliografischen Handapparat ergänzt, dessen fortgeführte Sortierung nach Sachgebieten und Epochen (statt nach Alphabet) allerdings intransparent bleibt und anscheinend vornehmlich dem Anliegen dient, Mendelssohns Monografie weiter für sich stehen zu lassen – auch um die eigenen Ergänzungen abgesetzt davon deutlich zu machen. Eine Fundgrube für weiterführende Forschung ist das Literaturverzeichnis allemal.
Bezeichnend an der Zeitungsstadt Berlin in ihrer dritten Auflage erscheint, dass für die 35 fortzuschreibenden Jahre seit der zweiten Auflage 1982 gleich drei Autoren verantwortlich zeichnen, während Peter de Mendelssohn seine Leser durch die 365 vorangehenden Jahre souverän als Solist geleitet hat. Naturgemäß begegnen sich hier auch zwei Forschungsschulen. Im Grunde gehört einer aus der Generation von Mendelssohn noch gar keiner Schule an. Vielmehr schrieb er, der 1927 beim Berliner Tageblatt volontierte, später nach London emigrierte und 1936 bis 1970 mit Hilde Spiel verheiratet war, als Zeitzeuge, ja sogar Beteiligter. Als Presseoffizier der allierten Besatzungsmächte kehrte Mendelssohn 1945 nach Deutschland zurück und war unter anderem für die Lizensierung von Zeitungen wie Der Tagesspiegel und Die Welt zuständig. Auch wenn Mendelssohn sein Involviertsein im Vorwort angekündigt hat, ist man nach Jahrhunderten unauffälligen Erzähler-Geleits dann doch verdutzt, wie er auf Seite 608 seiner ausufernden Chronik plötzlich selbst auf den Plan tritt, wobei er immer dritte Person bleibt und meistens als „der Presseoffizier“ firmiert. Als solcher referiert Mendelssohn Insiderkenntnisse über die Vorgänge und Begleitumstände einer Lizenzerteilung.
Wo Mendelssohns Blick auf die Nachkriegsjahrzehnte etwas zeitungslobbyistisch (etwa in der Argumentation gegen den SFB) geraten und latent gegen den Geist von 1968 gerichtet war, setzen Hachmeister, Kramp und Weichert im Ergänzungskapitel noch einmal eigene Akzente. Obwohl sie den Faden nominell ab 1985, mit dem Tode Axel Springers aufnehmen, greifen sie noch einmal die (im letzten Mendelssohn-Kapitel nur sehr knapp gewürdigte) Gründung der tageszeitung (taz) auf – nicht nur als Modell für linksalternativen Journalismus, sondern auch mit Blick auf die später genossenschaftliche Verlagsstruktur. Die Frischzellenkur, die das journalistische Feld der taz verdankt, sowohl in Bezug auf das Medienpersonal als auch den Stil und namentlich mit Blick auf die popjournalistische Feuilleton-Konzeption aller Zeitungen, wird von den Autoren kaum explizit gewürdigt. Im Mittelpunkt ihrer Darstellung stehen vor allem Ereignisse, die das Mediensystem betreffen, etwa das Engagement der Konzerne Holtzbrinck, Gruner + Jahr, Neven DuMont und die kartellrechtlichen Schlachten um den Berliner Verlag bzw. die Berliner Zeitung , die in den 1990er Jahren zur „deutschen Washington Post “ ausgebaut werden sollte. [3]
Ergiebig ist das Konzept der Fokussierung auf Medienstrukturen da, wo es um die mit dem Regierungsumzug verbundenen Investitionen in die zwischenzeitliche Berlin -Seite der Süddeutschen Zeitung bzw. die Berliner Seiten der Frankfurter Allgemeinen geht. Im Blick auf den Niedergang dieser Formate vermisst man (im Sinne einer deutschlandweiten ausgreifenden Pressegeschichte, wie sie sich Mendelssohn immer wieder gestattet) wiederum den Hinweis, dass 2002 etwa auch das popjournalistisch mindestens so profilierte jetzt -Magazin der Süddeutschen Zeitung eingestellt wurde. Für ein akkurates Geschichtswerk mutet es latent schludrig an, dass die Autoren den im Folgenden erwähnten Berliner Magazin-Neugründungen Dummy , Monopol oder Cicero kein einziges Mal das Gründungsjahr zur Seite stellen. Immerhin taucht Cicero in der separaten Zeitleiste am Schluss des Buches auf, die mit der Berufung Ulf Poschardts zum Chefredakteur der Welt endet, während der Fließtext mit Mathias Döpfners Engagement als BDZV-Präsident schließt. Das ist sinnfällig für die Hoffnung vieler Zeitungsverlage, auch in Zukunft noch, und das heißt womöglich exklusiv digital, Journalismus unternehmen zu können.
Berlin – und damit schließen Hachmeister, Kramp und Weichert – erscheint unter diesen Bedingungen als „Brennglas“ einer digital diversifizierten Medienproduktion und Mediennutzung, in der Papier zum Auslaufmodell wird. Vom Blätterwald zum Brennglas: ob diese Metaphorik den unaufhaltsamen Schwelbrand bewusst eingepreist hat? Den Zahlen zufolge beträgt der jährliche Schwund der Druckauflage (2006 bis 2016) in der Zeitungsstadt Berlin 8 bis 11 Prozent, bundesweit liegt er bei nur 2 bis 3 Prozent. Sollten sich künftige Entwicklungen in Berlin vorab manifestieren, dann können wir den Strukturwandel der Branche jetzt nur weiter neugierig verfolgen. Schon für Peter de Mendelssohn schien jedenfalls eine „Zeitung, die nicht mehr geschrieben, nicht mehr gesetzt, nicht mehr gedruckt, nicht mehr am Kiosk verkauft oder von der Botenfrau in den Briefkastenschlitz gesteckt wird, die nur noch in kürzesten, knappsten Sätzen von einem Bildschirm abzulesen ist, eine gewisse Vorstellung“ (S. 688).“
Marc Reichwein , 30.11.2017
Anmerkungen:
[1] Die Idee, dass branchenfremdes Engagement der Medienbranche eher schadet als nützt, ist ein Topos der Medienkritik bis heute. Er kommt auch zum Tragen, wenn die Autoren Hachmeister, Kramp und Weichert das endlos schreckliche Schicksal der Berliner Zeitung seit der Wende resümieren.
[2] Vgl. insbesondere die Ausführungen zum Materndienst (S. 392-407) sowie zu Figuren wie Max Winkler (448-464) und Max Amann (465-579).
[3] In der Beobachtung, dass Berlin weder historische noch gegenwärtige Zeitungen von deutschlandweiter oder gar internationaler Geltung hervorgebracht hat, sind sich Hachmeister/ Kramp/Weichert und Mendelssohn überzeitlich verblüffend einig. In diesem Befund spiegelt sich die föderale Verfasstheit Deutschlands mit seiner späten Etablierung Berlins als Hauptstadt fraglos wieder.