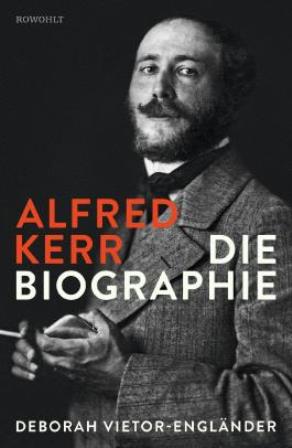Deborah Vietor-Engländer: Alfred Kerr. Die Biographie. Reinbek: Rowohlt, 2016. 720 S. ISBN: 978-3-498-07066-3. Preis [A]: 27,80 €
Wenn man Kerr durch die Polemiken von Karl Kraus kennen gelernt hat, ist man geneigt, dessen Urteil über Kerr zu übernehmen. Die Lektüre einiger Kerr’schen Kritiken hat mich auch nicht unbedingt davon überzeugt, dass man den Berliner Theaterkritiker lesen müsse – zu selbstverliebt schien und scheint mir ihr Stil. Dass diese monumentale Biografie mich zum Überdenken meiner Meinung über den Berliner Kritiker veranlasst, spricht für die Autorin, die, das sei gleich vorweggenommen, Kerr nicht vorbehaltlos verehrt, sondern Distanz zu ihrem Gegenstand zu wahren weiß und auch die eine oder andere weniger sympathische Eigenschaft des Autors andeutet. Man merkt, dass sie sich schon lange mit Kerr und seinen Schriften beschäftigt.
Die Biografie ist gründlich recherchiert, die Quellenlage offenbar nicht ungünstig. So kann Vietor-Engländer viele Privatbriefe zitieren, vor allem aus den Exiljahren. Sie zeigen Kerr (1867–1948) als sensiblen und liebevollen Menschen, der nach 1933 viel durchgemacht hat, und als guten Briefschreiber. Das nicht gerade ereignislose Privatleben des Kritikers kommt auch in früheren Kapiteln zur Sprache, doch bleibt das Buch sachlich und vermeidet jede Indiskretion.
Ohnehin stehen diese Aspekte nicht im Vordergrund dieser Biografie. Zwar geht sie mehrfach auf Kerrs Verhältnis zum Judentum ein, dem gegenüber er stets loyal war, ohne religiös zu sein; doch in der Zeit, in der er lebte, war das Verhältnis eines Menschen zu dieser Religion ohnehin keine Privatsache mehr. Obwohl Vietor-Engländer das Leben Kerrs in seiner Gesamtheit zu fassen sucht, liegt der Schwerpunkt – zu Recht – auf dem öffentlichen Kerr, auf allen Seiten seiner publizistischen und literarischen Tätigkeit. Er war ja nicht nur ein prominenter und einflussreicher Kritiker, sondern schrieb auch Feuilletons und Reisebücher und den einen oder anderen gewichtigen Text mit politischer Intention. Seine peinliche patriotische Lyrik am Beginn des Ersten Weltkriegs wird nicht verschwiegen. (Wie überhaupt immer wieder Verse von Kerr zitiert werden, obwohl sie nicht seine starke Seite gewesen sind.)
Der breite Ansatz dieser Biografie bringt es mit sich, dass man viel über die Geschichte des Berliner Theaters, über die Bedingungen der Theaterkritik, über Konflikte zwischen den Kritikern und über literarische Polemiken erfährt, auch über die für Kerr relevanten Medien (darunter schon der Rundfunk). Sehr viel deutsche Literaturgeschichte des ersten Drittels des vorigen Jahrhunderts kommt in dieser Biografie vor, insbesondere das Drama der Epoche. Dass Kerr zu Brecht keinen Zugang gefunden und Toller höher geschätzt, dass er nie sein persönliches Vorurteil gegenüber Thomas Mann überwunden hat, wird ausführlich behandelt. Recht symptomatisch für die Entwicklung der deutschen Kultur in diesen Jahrzehnten scheint mir, dass andere Zentren des deutschen Theaterlebens als Berlin – etwa München und Wien – Kerr wenig interessiert haben (seinen positiven Urteilen über den, eben in Berlin gespielten, Ödön von Horváth zum Trotz). Negative Urteile von Zeitgenossen über Kerr werden im Sinn eines Gesamtbilds ebenfalls zitiert, z. B. eine enttäuschte Notiz von Gerhart Hauptmann aus dem Jahr 1912 (S. 228) oder der Vorwurf Thomas Manns (1913), Kerr missbrauche sein „Kritikeramt“ zum Ausdruck „privater Gehässigkeit“ (S. 238).
In diese glanzvolle Berliner Zeit fällt die Entwicklung von Kerrs Anspruch, Kritik sei eine eigene literarische Gattung: „Was Dichtung zu geben hat, gab meine Dichtung der kritischen Kunst. Fortan ist zu sagen: Dichtung zerfällt in Epik, Lyrik, Dramatik und Kritik.“ (1917, zitiert auf S. 262) Dieses Selbstbewusstsein allein konnte Kerrs Stil rechtfertigen, der immer manieristischer wurde und den Informationsgehalt seiner Rezensionen zunehmend reduzierte. Brecht (1926, zitiert auf S. 349) formuliert das so: „Der Zusammenhang zwischen Herrn Kerr und mir ist äußerst vage. Er besteht hauptsächlich darin, dass man ihm anlässlich meiner oder anderer Werke gestattet, seine Ansichten über eine Reihe von Gegenständen zu äußern, die mit diesen Werken in keinerlei erkennbarem Zusammenhang stehen.“ Auf dieses Problem der Kerr’schen Auffassung von Kritik und auf die Schattenseiten seines Stils, für den der Witz wichtiger geworden war als die Information, geht Vietor-Engländer nur wenig ein; aber das ist auch nicht das primäre Thema einer Biografie.
Vietor-Engländer stellt besonders Kerrs Wirken in der Weimarer Republik und dessen Umfeld sehr packend dar (und hat sehr viel historische Forschungsliteratur eingearbeitet). Das Engagement des Schriftstellers für den demokratischen Staat und gegen den Nationalsozialismus wird ebenso gewürdigt wie seine Sympathie für die Revolution in Russland. Insgesamt sind die Abschnitte über die Jahre von 1918 bis 1933 wahrscheinlich die besten des Buchs.
Denn sie präsentieren den öffentlichen Kerr. Das Jahr 1933 reduzierte ihn brutal auf einen Privatmann, der darauf beschränkt war, Geldmittel für das Überleben seiner Familie aufzutreiben und oft genug zu erbetteln. Obwohl Vietor-Engländer in den Exilkapiteln – treffend „Der Sturz ins Nichts“ überschrieben – nicht so straff erzählt wie in den vorhergehenden Teilen, weil sie im Prinzip nach der Chronologie, dann aber doch immer wieder nach Themen gliedert, sind diese Abschnitte ungemein berührend: Denn gerade im Kontrast zum vorher recht glanzvollen Leben der Kerrs wird deutlich, was die Vertreibung bedeutet hat. Man kann diesen Teil des Buchs nur erschüttert lesen, erschüttert auch darüber, dass nach bloß 12 Jahren der Name Kerr nur noch einigen alten Freunden etwas sagte, sonst im Grunde niemandem mehr in Deutschland. Das ist ja nicht nur Kerr so gegangen.
Ein paar kleinere Fehler seien angemerkt: Kraus’ Heine-Essay heißt Heine und die Folgen (S. 199); Der Verschwender ist von Raimund, nicht von Nestroy (S. 321); Theodor Tagger ist nicht das Pseudonym von Ferdinand Bruckner, sondern Ferdinand Bruckner das von Theodor Tagger (S. 346). In einer zitierten Besprechung von 1927 steht „Kraus“, gemeint ist aber offensichtlich Werner Krauss (S. 354). Einige Unschärfen finden sich in der Darstellung der Polemiken von Kraus gegen Kerr. Eine orientierende Zeittafel wäre nützlich.
Das sind Kleinigkeiten, die der Leistung von Deborah Vietor-Engländer in keiner Weise Abbruch tun. Diese überdies gut lesbare, viele interessante Details bietende Biografie sollte jeder konsultieren, der sich mit der deutschen Literatur und dem deutschen Theater im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts und mit der Exilliteratur beschäftigt; auch für die Geschichte der Theater- und der Literaturkritik ist das Buch wichtig. Leben und Werk Kerrs erweisen sich als exemplarisch.
Sigurd Paul Scheichl , 17.01.2017