Ö1-Hörern ist Peter Zimmermann als Gestalter der wöchentlichen Büchersendung Ex libris bekannt. Der ORF verbucht ihn als „ Star “. Mit einer solchen Worthülse bekleidet zu werden, dürfte womöglich schon zu den höheren Formen des Scheiterns im Spiel-Raum des literarischen Feldes zählen – zumindest für einen kritischen Zeitgenossen wie Peter Zimmermann, der offensichtlich nicht nur Bourdieu gelesen hat, sondern darüber hinaus allen marketingbedingten Etikettierungsversuchen zum Trotz mit dem Anspruch antritt, eine Lanze für das widerständige Potential „avancierter Literatur“ zu brechen. Und das notabene in Zeiten eines alles nivellierenden Marktes und einer vor keiner Oberflächlichkeit zurückschreckenden Literaturbetriebsamkeit. Für Literatur als Kunst, die noch nicht „zur kleinen Mahlzeit zwischendurch verkommen“ ist, plädiert er auch in seinem neuen Buch mit dem durchaus selbstironischen Titel Schule des Scheiterns , in dem es neben kritischer Autobiographik über Kindheit und Jugend in der geistfernen Kärntner Provinz vor allem um eines geht: um die wortreiche Inszenierung von Zimmermanns Hader mit dem gegenwärtigen Zustand einer Branche, deren Mechanismen sich der Autor sowohl in seiner Rolle als Kritiker wie als Romancier (der er auch ist) auf Gedeih und Verderb ausgeliefert weiß. Von den meisten Texten des Buches steht zu vermuten, dass sie bereits einmal an anderer Stelle als Kolumne publiziert worden sind (leider fehlen hierzu genauere Quellenangaben). Aus der aktuellen Anlassgebundenheit mancher Polemiken ließe sich jedenfalls ihr aufgeregter Tonfall erklären, der sich durchs gesamte Buch zieht – und der überraschen muss, wenn man den Autor lediglich aus dem sonntäglichen Hörfunkprogramm als dezenten Moderator kennt.
In der Schule des Scheiterns versucht sich Zimmermann also im Levitenlesen, und wenn er die zunehmende inhaltliche Uniformität der Feuilletonseiten und die allmähliche Unterwerfung des literaturkritischen Schreibens unter das Diktat betriebswirtschaftlich begründeter Vorgaben kritisiert, wenn er die sich deutlich abzeichnende „Verflachung“ des alljährlichen Klagenfurter Wettlesens bemerken muss und bei Betrachtung des Leipziger Literaturinstituts und seiner Absolventen die Erlernbarkeit des Schriftstellerberufs in Frage stellt, so ist man als Leser nur allzu schnell bereit, dem Kritiker zuzustimmen. Wer wollte schon widersprechen, wenn Zimmermann von der Literatur mehr erwartet als seichte Unterhaltung, wenn er beim Lesen eines „guten“ Buches eine wie auch immer geartete „existentielle Erschütterung“ einfordert − und wenn er das Erlebnis einer solchen am Beispiel der eigenen frühen Handke- und Jonke-Lektüre durchaus überzeugend und feinfühlig darzustellen versteht.
Dennoch: Besagte Feinfühligkeit ist leider kein Grundcharakteristikum aller hier versammelten Kommentare und Glossen. Nur allzu oft vermisst man die viel beschworene feine und zugleich „scharfe Klinge“, welche zu führen Zimmermann u. a. von Josef Bichler im Standard (Nr. 6025 vom 8.11.2008) bescheinigt worden ist. Aber statt diesem nachgerade unvermeidlich zu nennenden Ausrüstungsgegenstand im Waffenarsenal eines jeden ob seiner „Brillanz“ gelobten Kritikers bekommt man bei Zimmermann häufig genug nur die plumpe Keule des zur Blindwütigkeit neigenden Polemikers zu Gesicht. Die Keule nämlich, und nicht das punktgenau treffende Florett, hat sich durch die Jahrhunderte hindurch noch immer als das geeignetste Instrument zur Verteilung undifferenzierter Rundumschläge bewährt. Und um solche handelt es sich, wenn Zimmermann etwa daran geht, prominente Vertreter der österreichischen Gegenwartsliteratur abzuwatschen − von Menasse über Einzinger bis Kehlmann. In deren Erfolgen nämlich will er vor allem eines erblicken: Den „Triumph der Halbtalente. Und de[n] wahre[n] Tod des Autors.“
Aber auch jenseits der engeren österreichischen Grenzen glaubt Zimmermann in den gegenwärtigen Verlagsprogrammen nicht viel Hoffnungsfrohes ausmachen zu können, so dass sich der Radius seines Rundumschlags nahezu beliebig erweitern lässt. Das liest sich dann folgendermaßen:
„Ich leide […] unter der frappierenden Irrelevanz des Geschriebenen. […] Klappe ich ein Buch zu, habe ich nichts erfahren. In einigen Monaten werde ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich es gelesen habe.“
Und warum ist das so? Die Antwort liegt für Zimmermann nach einem mehr oder weniger tiefen Blick in die „Musterkoffer der Großverlage“ auf der Hand:
„Weil keine Zeit mehr ist, weil das Zeug in Umlauf gebracht werden muss, weil das Neue nie neu genug sein kann, weil Bücher nach zwei Monaten offensichtlich schon Schimmel ansetzen und nach zwei Jahren sich keiner mehr an ihr Erscheinen erinnert.“
Spätestens bei diesen Sätzen beschleicht einen das Gefühl, solcherlei irgendwo schon einmal gelesen zu haben. Diesen Gestus des Überdrusses und der kulturkritischen Larmoyanz, mit dem der Ankläger sich bemüßigt fühlt, die von ihm erkannten Übel unter der fett gedruckten Überschrift „Grundsätzlich“ endlich einmal beim Namen zu nennen. Womit ihm allerdings lediglich gelingt, die Grundstimmung eines latenten „Früher war alles besser“ zu evozieren. Die Diagnose aber, dass der wirklich guten Literatur unter dem Paradigma der verlegerischen Gewinnmaximierung und der massenmedial befeuerten Sensationsgier nach schnell konsumierbaren Novitäten längst der Atem ausgegangen sei, während auf Seiten der Leser die Bereitschaft fehle, sich auf anspruchsvolle Lektüre einzulassen, ist in der Tat alles andere als neu. Früher klang das z. B. so:
„Wer grundsätzlich kein Buch kauft, das gerade Mode ist, dem ist seit dreißig Jahren nicht ein einziges Werk von wirklicher Bedeutung entgangen. Und umgekehrt: wer seit dreißig Jahren alljährlich nur das Buch der Saison gekauft hat, besitzt heut eine Bibliothek ebenso buntscheckig wie zum Sterben langweilig: lauter Bücher, die nicht zusammenpassen, und von denen er kaum eins noch lesen mag. Darum ist der erste Rat für Bücherkäufer: Kaufen Sie niemals das Buch, von dem alle Welt spricht!“
Diese Sätze stammen nun allerdings nicht von Peter Zimmermann, sondern von Josef Hofmiller, dessen 75. Todestag im Oktober 2008 zu begehen gewesen wäre, hätte sich denn heute noch irgendjemand an diesen einstmals gefürchteten Kritiker konservativer Observanz erinnert, der sich zu der Zeit, in der er die zitierten Sätze unter dem Titel Die Bücher und wir zu Papier brachte (man schrieb das Jahr 1932), immerhin auf dem besten Wege befand, als ein Meister der deutschen Essayistik die höheren Weihen der Kanonisierung zu erfahren. Dieser Prozess hat zwar durch den allmählichen Interesseverlust an bildungsbürgerlichen Moralpredigten nach Ende des Zweiten Weltkriegs seinerseits ein relativ rapides Ende gefunden und war auch durch diverse Reaktivierungsversuche im restaurativen Klima der 1950er Jahre nicht wieder erfolgreich in Gang zu bringen, doch zeigt der Vergleich zwischen dem verhinderten Klassiker von einst und dem immerfort das eigene „Scheitern“ an den Zwängen des Betriebs zelebrierenden Kritiker von heute, dass sich die Positionen eines kulturkonservativen Schulmeisters − der Hofmiller bei all seiner Bedeutung für die Geschichte des deutschsprachigen Essays nun einmal war −, und diejenigen eines sich mit nonkonformistischer Attitüde irgendwie „links“ definierenden Intellektuellen zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht zwangsläufig widersprechen müssen. Da werden unfreiwillige Kontinuitäten sichtbar, die bestenfalls ein müdes Gähnen provozieren.
Ob Zimmermann der Vergleich mit einem politischen Reaktionär wie Hofmiller nun gefällt oder nicht, es gibt da noch eine Reihe weiterer Gemeinsamkeiten: Den Hang zu breit ausgewalzter Metaphorik etwa, die auf offenkundige Weise das Kulinarische als bildspendenden Bereich bevorzugt. Aber weil Zimmermann − anders als der vielfach doch noch um einiges rigorosere Hofmiller − immerhin weiß, dass sich über Geschmack nicht streiten lässt, darf bei ihm der Griff in die Metaphernkiste wahlweise auch mal Montanistisches zu Tage fördern. So rät Zimmermann dem Leser denn auch, sich aufzumachen zu den Halden des „weitgehend ungelesene[n] Textgerölls“, in welchem er − womöglich wieder einmal nicht ganz zu unrecht − den „interessanteren Teil der literarischen Produktion“ verborgen wähnt, eben „weil sich Rohdiamanten immer erst nach mühsamer Grabung finden lassen und weil avancierte Kunst nicht mehrheitsfähig ist.“
Auf einen weiteren Band gesammelter Texte aus Zimmermanns Feder, der solche Grabungsfunde endlich ans Licht brächte, dürfte man also durchaus gespannt sein. Sein Erscheinen wäre sogar äußerst wünschenswert, zumal Zimmermann dann − wie zu hoffen ist − auch Gelegenheit fände, ein bisschen mehr an konstruktiver Wertung an die Stelle seiner im vorliegenden Fall nur halbwegs ironisch verbrämten Negativität zu setzen. Eine solche Lektüre schiene jedenfalls um einiges ergiebiger, als das Blättern in mitunter recht redundant anmutenden Texten voller Invektiven und wenig origineller Klagen über die hinlänglich bekannten Verfallserscheinungen des Literaturbetriebs. Denn wie heißt es doch in der Kritikerschelte des Kritikers Zimmermann: „In Wirklichkeit haben sich die Gnostiker längst aus dem Arbeitsbündnis Autor – Leser – Kritiker in die selbstreflexive Kritikkritik verabschiedet.“ − Eben.
Michael Pilz , 29.04.2009
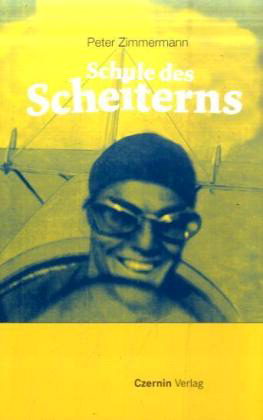
Peter Zimmermann: Schule des Scheiterns. Texte. Wien: Czernin, 2008. 202 S. ISBN 978-3-7076-0280-7. Preis [A]: € 19,80