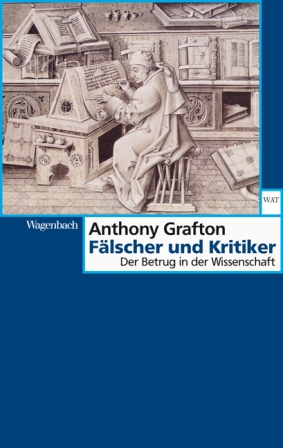Anthony Graftons buchfüllender Essay über Forgers and Critics von 1990 ist vor einundzwanzig Jahren in Wagenbachs Kleiner Kulturwissenschaftlicher Bibliothek erstmals auf Deutsch erschienen und war seit längerem vergriffen. Dass ihn der Verlag ausgerechnet jetzt wieder neu auflegt, vermag kaum zu verwundern, scheint ein Buch mit dem Untertitel Der Betrug in der Wissenschaft in Zeiten der Guttenplag -Galaxis, in der das anhaltende Medieninteresse an der Inauthentizität wissenschaftlicher Qualifikationsschriften (insbesondere von Spitzenpolitikern) ehemalige CSU-Aufsteiger mit inzwischen ebenso ehemaligen ungarischen Staatspräsidenten und neuerdings auch mit rumänischen Ministerpräsidenten in einer Liga der unehrenwerten Gentlemen vereinigt, aktueller denn je zu sein. Das Thema hat also Konjunktur – und doch, um es gleich vorwegzunehmen: Graftons Thema ist es nicht. Denn um Plagiate geht es keineswegs in seinem Buch, dem insofern auch kaum prophetische Qualitäten in Bezug auf eine erst nach seinem Ersterscheinen virulent gewordene Debatte zugesprochen werden können. Und das ist auch gut so. Denn der Gegenstand, über den Grafton gewohnt souverän und – in bester angloamerikanischer Tradition stehend – äußerst vergnüglich erzählt, ist ein mindestens ebenso interessantes und letztlich wohl auch bedeutsameres Phänomen der europäischen Wissenschaftsgeschichte, als es die notorischen Betrügereien zur Erlangung akademischer Grade sind.
Statt mit uninspiriertem Datenklau und nicht-ausgewiesenen Textzitaten bei der Erstellung wissenschaftlicher Sekundärliteratur beschäftigt sich der amerikanische Historiker nämlich vorrangig mit der editorischen Fälschung von Quellentexten – jenem Bereich der geisteswissenschaftlichen Textproduktion also, in dem Gelehrte und Wissenschaftler klammheimlich zu Autoren vorgeblicher Primärliteratur werden, um dann in der Rolle des findigen Finders oder gewissenhaften Herausgebers um das symbolische und bisweilen sogar um das ökonomische Kapital des akademischen Feldes wetteifern zu können. Dass die Erlangung wissenschaftlicher Lorbeeren jedoch längst nicht das einzige Motiv für die Produktion literarischer Fälschungen war und ist, macht Grafton in seiner profunden tour de force durch rund dreitausend Jahre europäischer Geistesgeschichte deutlich, wenn er z. B. auch die diversen Legitimationsstiftungen religiöser und nationalpolitischer Art in den Blick nimmt, die sich von der Antike bis zur Renaissance auf gefälschte Textzeugnisse in Urkundensammlungen, Chroniken und anderen Produkten kollektiver Traditionsbildung stützen konnten. Letztlich spannt sich das von Grafton beleuchtete Themenspektrum vom bloßen akademischen Jux über den ernst gemeinten Betrug bis in die Randzonen dessen hinein, was bei fiktionalen Texten unter dem Begriff der „Herausgeberfiktion“ zu verbuchen wäre (vgl. S. 10; S. 40). Der Fokus von Graftons Interesse liegt dabei insbesondere auf der Frühzeit der philologisch-historischen Forschung, deren Anfänge und Vorläufer er mit großer Findigkeit unter Umschiffung der hinlänglich bekannten Epochenschwelle des Humanismus bis in die Antike zurückverfolgt. In der entgegengesetzten Richtung des Zeitstrahls kommt Graftons Darstellung indes über das 18. Jahrhundert – von einzelnen Beispielen abgesehen – kaum wesentlich hinaus, wobei insbesondere der berühmte Fall des Thomas Chatterton exemplarisch herausgegriffen wird (während die im gesamteuropäischen Kontext letztlich wohl wirkmächtigeren Fälschungen des Ossian-Autors James Mcpherson nur am Rande Erwähnung finden).
Die zeitliche Beschränkung gereicht dem Buch jedoch keineswegs zum Nachteil, zumal es Grafton überhaupt nicht um eine enzyklopädisch vollständige Ausbreitung der eklatantesten Fälschungsfälle geht, sondern vielmehr um einen konzisen Überblick über das dialektische Verhältnis von Betrug und Aufdeckung in der Wissenschaftsgeschichte, mithin also um den bereits im Titel anvisierten Aufweis einer wechselseitigen Befruchtung von immer detaillierter arbeitenden Fälschern einerseits und auf diese Herausforderung mit immer akribischeren Methoden der Quellen-, Stil- und Textkritik antwortenden Philologen andererseits. Indem er sein Interesse also nicht nur den (mehr oder weniger) genialen Fälschern zuwendet, sondern in nicht minderem Maße eben auch den wissenschaftlichen Kritikern, erzählt Grafton Philologiegeschichte als Geschichte einer stetigen Auseinandersetzung zwischen beiden Instanzen samt ihren Motiven, Anlässen und Methoden: „Fälscher und Kritiker waren durch die Zeiten verschlungen wie Laokoon und seine Schlangen; und die wechselhafte Natur ihres anhaltenden Kampfes gehört zu den zentralen Themen in der Entwicklung der historischen und philologischen Forschung.“ (S. 11).
Worum es Grafton mithin zu tun ist, wenn er vom „Betrug in der Wissenschaft“ schreibt, ist die Darstellung der Wirkungen dieses Betrugs auf das Selbstverständnis und die Arbeitsweisen der philologischen Disziplinen, die sich zu Hüterinnen kritischen Denkens und Prüfens im Namen einer objektivierenden „Echtheitskritik“ erklären konnten. Zu den zahlreichen Kontinuitäten, die Grafton im Rahmen seiner Untersuchung herausarbeitet, gehört dabei die notwendige Einsicht in den Konstrukt-Charakter dieses Objektivitätsanspruchs, der auf die unverändert gegebene Bedingtheit jeder „Echtheitskritik“ respektive die Standortgebundenheit der Kritiker selbst verweist. Grafton legt dies in einem furiosen Dreischritt am Beispiel des antiken Philosophen und Bibelkritikers Porphyrios (3. Jahrhundert), dem Humanisten Isaac Casaubon (1559–1614) und dem in seiner Methodik bereits kulturwissenschaftlich orientierten Altphilologen Richard Reitzenstein (1861–1931) aus dem Umfeld Aby Warburgs offen, die alle drei mit analytischer Genauigkeit Fälschungen aufgedeckt hatten, die ihren eigenen Überzeugungen oder gar Glaubenslehren entgegenstanden. Indes: „Alle ließen sehr viel weniger kritisches Einsichtsvermögen erkennen, sobald es um Schriften ging, die ihren Meinungen und Wünschen entsprachen.“ (S. 106). Woraus folgt: „Echtheitskritik ist […] in ihren Schlußfolgerungen zwangsläufig fehlbar und schuldet der Fälschung in ihrer Methodik viel. Ihre Motive sind häufig parteiisch und unwissenschaftlich. […] Der Kritiker […] wird ständig von seiner eigenen Subjektivität verraten.“ (S. 142).
Besonders erhellend erscheinen jene Abschnitte in Graftons Studie, die sich dem Ursprung eines regelrechten Fälschergewerbes als Produkt des Literaturmarktes und seiner Veränderungen in der Antike zuwenden. So wird nicht nur klar, dass die Anfertigung von Fälschungen überhaupt erst zum Auslöser für die Etablierung einer philologischen Kritik wurde, sondern dass beide Praktiken erst im Kontext vielfältiger struktureller Rahmenbedingungen entstehen konnten, die bereits für die Antike eine Art von „literarischem Feld“ (Bourdieu) absteckten, in dem Bibliotheken, Buchhandel und Bildungsinstitutionen als Konsekrationsinstanzen eines Kanonisierungsprozesses zusammenwirkten, der eine gesteigerte Nachfrage nach klassischen Vorbildern (sowohl als Muster für die stilistische Nachahmung in den Rhetorik-Schulen wie auch für Fälscher, die den Markt mit neuen „Originalen“ bedienten) produzierte. Grundlegende Voraussetzung dafür war wiederum ein spezifisches Verständnis von Originalität, welches an das auch heute noch immer dominante Konzept von Autorschaft gekoppelt war, demzufolge „ein literarisches Werk das Produkt eines bestimmten Individuums mit eigenem Stil und eigenen Zielen ist.“ (S. 16). Bereits die berühmten Pinakes des alexandrinischen Bibliothekars Kallimachos – gleichsam die antiken Vorläufer unserer modernen Personalbibliographien und Literaturgeschichten – konstituierten für die in ihnen verzeichneten Schriftsteller ein Autorität beanspruchendes Werk-Korpus an authentischen Texten, die streng von den als Fälschungen identifizierten Artefakten geschieden wurden:
Echte Werke eines Schriftstellers bezeichneten sie als gnesioi – rechtmäßig, der Ausdruck, der auch für eheliche Kinder benutzt wurde, unechte Werke waren nothoi – Bastarde; so umfaßt der antike Katalogos der Aischylos-Werke Aitnaiai gnesioi und Aitnaiai nothoi . Echte Schriften hatten, kurz gesagt, eine organische Verbindung zu dem Schriftsteller, der sie erzeugt hatte – und diese Beziehung unterschied sie von gefälschten Schriften, selbst wenn Bibliotheken und Aufstellungen letztere behalten mochten. (S. 18)
Insbesondere die Ankaufspolitik der berühmten Bibliotheken in Alexandria und Pergamon , die im dritten und zweiten Jahrhundert vor unserer Zeit gegründet worden waren, und die besonders hohe Preise für seltene Texte zu zahlen bereit waren, provozierte in der Folge nicht nur „die gezielte Herstellung eines sich selbst reproduzierenden Nachschubs durch Fälschung“ (S. 18) – sondern auch die Entwicklung einschlägiger philologischer Testmethoden zur Echtheitsbestimmung, die ihren literaturpolitischen Niederschlag in den jeweiligen Bibliothekskatalogen und Verzeichnissen der ebendort beschäftigten Gelehrten fanden. Grafton unterstreicht mit diesem Beispiel sowohl den ökonomischen Ursprung wie auch die enge Verflechtung von Fälschung und Philologie mit der Herausbildung eines Kanons, der sich unter den Bedingungen eines erstaunlich modern anmutenden Buchmarktes in der Antike etablierte: Die „reine Existenz [der Fälschungen] und deren Konsequenzen für den tatsächlichen Wert hochbezahlter Ankäufe und nicht so sehr abstrakte Überlegungen trieben also Gelehrte dazu, zu fälschen und gegen Fälschungen zu Felde zu ziehen.“ (S. 19).
Wie es den Fälschern dennoch gelang, über die Jahrhunderte hinweg ihre Texte „an den Hütern des Kanons vorbeizuschmuggeln“ und in diesen einzuspeisen (S. 72) ist ebenfalls Gegenstand von Graftons Essay, wobei auch hier erstaunliche Kontinuitäten zwischen Antike und Neuzeit offenkundig werden: Neben den zahlreichen textimmanenten Verfahren, die dazu dienen sollten, „den Imitaten Achtung zu verschaffen, sind Publicity-Geschrei und beträchtlicher Redeschwall das wichtigste äußere [Mittel]“ der Beglaubigung gewesen – was den deutschen Gelehrten Johann Burkhardt Mencke schon im Jahr 1727 zur Veröffentlichung zweier Reden veranlasste, die den bezeichnenden Titel Von der Charlatanerie oder Marcktschreyerey der Gelehrten trugen (vgl. S. 73). Spätestens an Stellen wie dieser wir dem Leser von Graftons Essay deutlich, dass sich die aufgezeigten Traditionslinien bruchlos bis in die unmittelbare Gegenwart des 21. Jahrhunderts verlängern ließen …
Michael Pilz , 25.06.2012