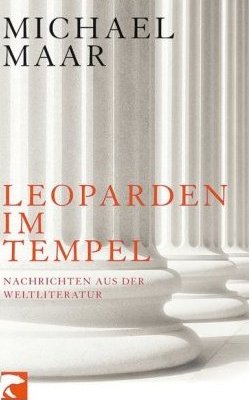„Michael Maar ist eigentlich eine sehr undeutsche Erscheinung.“ Das bescheinigt Daniel Kehlmann dem 1960 geborenen Germanisten und Literaturkritiker in einem Gespräch mit den Salzburger Nachrichten . Der vielfach ausgezeichnete Essayist sei vielmehr ein Kritiker im angelsächsischen Sinn, „wo es den Unterschied zwischen 'critic' und 'reviewer' gibt“ und wo man weniger Berührungsangst vor der Populärkultur habe. Dass er gegen diese tatsächlich keine Vorbehalte kennt, bewies Michael Maar etwa mit seinem Handbuch zu Harry Potter ( Hilfe für die Hufflepuffs , 1998). Mit den 12 biografischen Porträts, die unter dem Titel Leoparden im Tempel bei BvT neu aufgelegt worden sind, kehrt der diesjährige Heinrich-Mann-Preisträger dennoch in die Gefilde der Hochliteratur zurück.
Die nun im Taschenbuch erhältliche Essaysammlung war erstmals 2007 bei Berenberg erschienen. Ihre Texte haben Leben und Werk scheinbar sehr verschiedener Autoren zum Thema. Die meisten davon sind Neufassungen und Überarbeitungen früher publizierter Artikel (u. a. aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung , der Weltwoche und der Zeit ), die Aufsätze über Lampedusa und über die teuflische Sphäre in den Werken Thomas Manns dagegen Erstveröffentlichungen. Einige der Essays kreisen um Autoren, denen sich Maar in den letzten Jahren bereits in wichtigen Monographien genähert hat. Erwähnt seien an dieser Stelle Proust ( Proust Pharao , 2009), Nabokov ( Solus Rex , 2007) und Thomas Mann ( Das Blaubartzimmer , 2000). Gerade letzteren hat die Forschung schon hinlänglich, wenn nicht gar erschöpfend behandelt; trotzdem kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Maars Studien zu den essenziellen Reflexionen über den jeweils gewählten Gegenstand gehören und in diesem Fall sogar eine wichtige Ergänzung darstellen. Andere Texte in Leoparden im Tempel widmen sich Autoren, die zwar zweifelsohne kanonisiert sind, von denen man aber zunächst nicht sicher sagen könnte, ob sie tatsächlich – wie der Untertitel suggeriert – zur Weltliteratur zu zählen sind: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gilbert Keith Chesterton und Anthony Powell. – „Zunächst“, denn nach der Lektüre der vorliegenden Feuilletons dürften alle diesbezüglichen Zweifel ausgeräumt sein.
Das titelgebende Zitat von den „Leoparden im Tempel“ stammt aus einem Fragment Kafkas, das Maar zur Beantwortung der Frage dient, ob und wie allegorisch Leben und Werk des Prager Enigmatikers zu interpretieren seien. Als „Leopardenzähmer“ bezeichnet er die zahlreichen Exegeten Kafkas, die davon ausgehen, dass ein „dechiffrierbares Rätsel vor[liege] und kein unlösbares Geheimnis; alles andere ließe den Spürsinn und den Ehrgeiz des genau-Wissen-Wollens zu schnell erschlaffen.“ Maar, getrieben von starkem Erkenntniskitzel und ebensolchem Ehrgeiz, vermeidet es tunlichst, zu einem Leopardenzähmer zu werden. Wenngleich es sein Anspruch ist, jedes Rätsel zu lösen und damit die großen Geheimnisse (der Weltliteratur) zu lüften: im Falle Kafkas akzeptiert er nicht nur Rätsel und Geheimnis, sondern er geht sogar einen Schritt weiter und glaubt an ein Wunder.
Maar sucht nach den großen Zusammenhängen, hinterfragt gängige Lesarten und stellt lang tradierte Forschungsmeinungen in Frage. Bei seiner Suche stößt er nicht selten auf bislang unbekannte Details. An der Fülle solcher Einzelheiten (und der Bedeutung, die Maar ihnen beimisst) erkennt man, dass er sein Auge an Vladimir Nabokov geschult hat.
Nabokov ist neben Thomas Mann und Jorge Luis Borges auch einer der Autoren, die die Essays miteinander verklammern. In beinahe jedem Aufsatz dient mindestens ein Dichter aus dieser Trias als Bezugsgröße. Auf Maar scheint also auch zuzutreffen, was er an Borges – im positiven Sinne – konstatiert, nämlich „dass er eine ganze Bibliothek im Adlernest seines Gedächtnisses mit sich herumtrug und doch immer wieder auf ein paar Lieblingsgeschichten zurückkam.“ Das Zitat stammt aus dem Aufsatz Immer der Schildkröte nach! , in dem sich Maar mit dem argentinischen Dichter als Essayisten auseinandersetzt. Hier lernt der Leser Maar als einen Autor kennen, der beim anderen sieht und erkennt, was sein eigenes Schreiben ausmacht. Wie Borges' Feuilletons neigen auch die Maar'schen zum Erzählerischen, und der Schüler bleibt ganz nach dem Vorbild des Lehrers „dem Wortsinn des Essays treu“: er schickt „seine Gedanken in alle möglichen Richtungen.“ Was den Essay als literarische Gattung außerdem in hohem Maße ausmacht, ist sein Stil. Und Maar ist zweifelsohne ein glänzender Stilist.
Das ist nicht das einzige, was er mit einem Autor wie Peter von Matt gemeinsam hat. Er nähert sich – wie der Zürcher Germanist – der Literatur oftmals über die Biografie des Autors und wählt zumeist eine stark psychologisierende Herangehensweise. Wer etwa wissen will, wie es sich auf das Werk Virginia Woolfs ausgewirkt hat, dass die Autorin von ihrer Familie „Ziege“ genannt wurde, dem sei der Text Zwei Meere unter zwei Monden ans Herz gelegt. In einem ausgesprochen informativen Aufsatz über Nabokov mit dem Titel Auerochsen und Engel führt Maar vor, wie es zum Geisterglauben des Autors (und damit zu den vielen „Geistern“ in dessen Werk) kam: Der Tod des Vaters, der 1922 in der Berliner Philharmonie von russischen Rechtsradikalen erschossen wurde, war angeblich von einem Medium vorhergesagt worden. Nabokovs Werk, das leider – abgesehen vom „Skandalbuch“ Lolita – nach wie vor im deutschsprachigen Raum wenig gelesen wird, das jedoch als Vorbild gerade für einige jüngere Autorinnen und Autoren von fundamentaler Bedeutung ist, wird von Maar aber nicht nur psychologisch interpretiert. Und so kitschig ihm – wie den Nabokov-Kritikern – manche Passage, so überoriginell manche Metapher und so flach ihm die Charaktere des Spätwerks auch erscheinen, so werde doch allein schon durch die große „Anzahl von Einfällen pro Seite“ all das wieder wettgemacht. Maar weist schließlich bewundernd darauf hin, dass Nabokov in seiner Prosa „überall vollständig präsent“ sei und dass noch der „kleinste Splitter“ das große Ganze enthalte.
In einem anderen bemerkenswerten Essay beschäftigt sich Maar mit dem Werk Elias Canettis, das von der Fähigkeit des Autors zum Hass und zum bösen Blick bestimmt sei. „Ohne den Blick des Hasses“, so Maar, „hätte er nicht die Malicen über Kraus, Mann, Sartre oder Freud verfaßt, die zum Besten zählen, was er überhaupt geschrieben hat.“ Dem wäre nur hinzuzufügen, dass Canetti wohl nicht nur Hass, sondern auch „Einflussangst“ (Harold Bloom) verspürt haben muss. Wie kaum ein anderer litt er unter der Konkurrenzsituation, der er sich mit seinem literarischen Schaffen ausgesetzt sah. Kein Wunder also, dass der Nobelpreisträger, der selbst in einem lebenslangen Aufbegehren gegen den Tod stand, erleichtert war, wenn Freund Hein einen Rivalen aus dem (literarischen) Feld räumte. Wenn überhaupt, dann wollte sich Canetti nämlich nur mit den toten Autoren messen, „denn einen Vorteil hat er schon jetzt vor ihnen: ihr Ziel ist erreicht, sie leben nicht mehr. Mit welchem von ihnen immer er wetteifern mag, alle Kraft ist auf seiner Seite. Denn dort ist keine Kraft, nur das bezeichnete Ziel. Die Überlegenen sind erlegt.“ (So Canetti in Masse und Macht ). Der Hass Canettis, das sei den Ausführungen Maars hinzugefügt, gründete also wohl auf Versagensangst und einem Gefühl der Unterlegenheit.
Beides muss den Autor des vorliegenden Bandes nicht quälen, denn Michael Maar versteht es, den Leser zu fesseln und für Literatur zu begeistern. Er schafft dies durch die Fähigkeit, Neues und bisher Unerforschtes ans Licht zu bringen und es in einer Sprache zu präsentieren, die unvergleichlich klug, witzig und leicht ist. Kurzum: Maar ist einer der bedeutendsten unter den Essayisten der Gegenwart, obwohl (oder gerade weil) er einer der „undeutschesten“ unter ihnen ist.
Irene Zanol , 06.09.2010