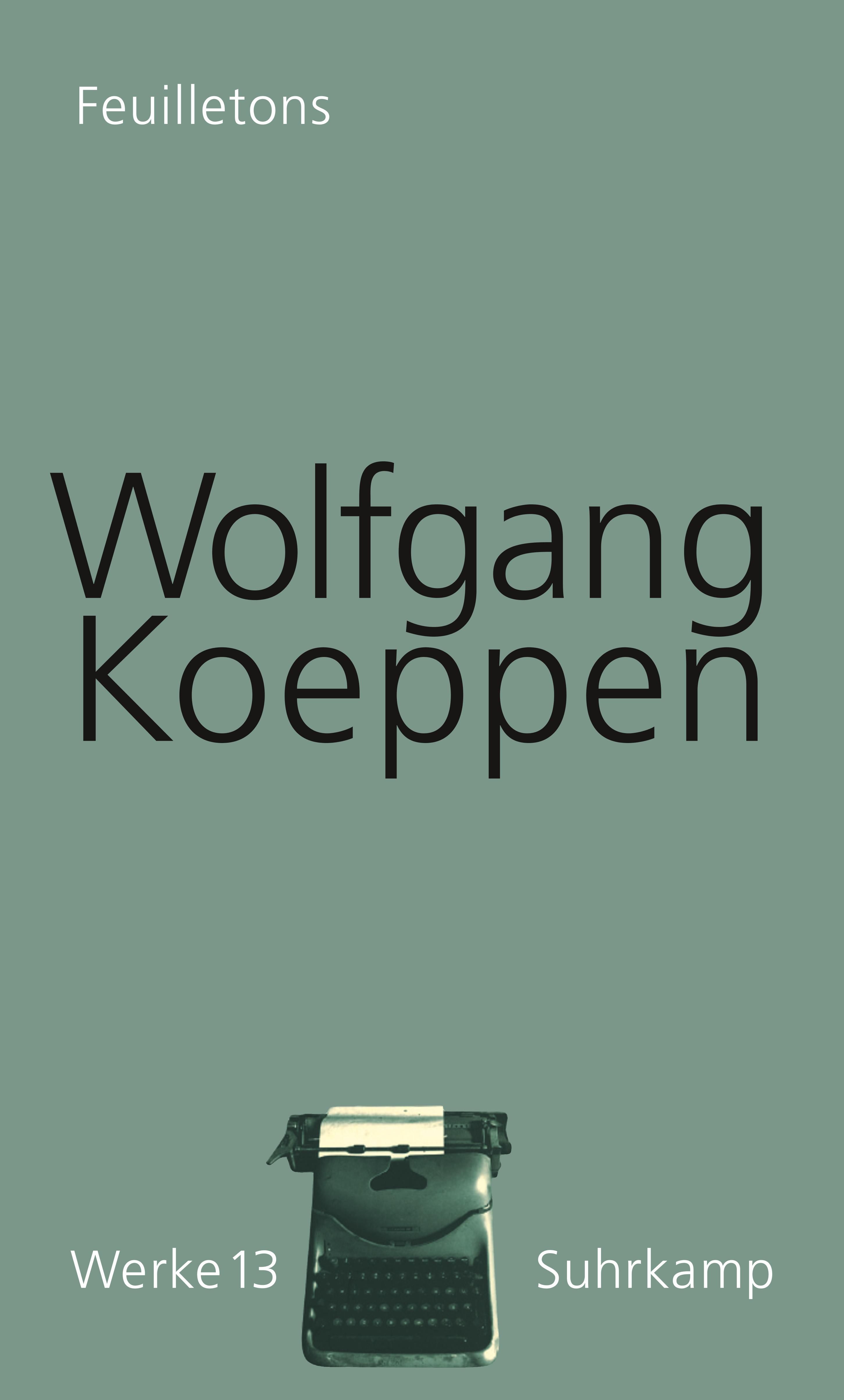Immer, wenn von Wolfgang Koeppen die Rede ist, wird auf sein literarisches Schweigen oder – je nachdem wie es geframt werden soll – seine Schreibblockade, seine Unproduktivität, sein Scheitern oder auch seine Faulheit Bezug genommen. Die tausenden Seiten seines Nachlasses werden dabei oft übersehen, obwohl diese als Teil seines Hauptwerks angesehen werden müssen.1 Ähnliches gilt für sein journalistisches Frühwerk. Der Klappentext des vor kurzem erschienenen 13. Bandes von Koeppens Werkausgabe beginnt mit den Worten: „Von Wolfgang Koeppen ist die Aussage überliefert, kein Bibliograph werde jemals in der Lage sein, sämtliche Zeitungsbeiträge aus seiner Feder vollständig aufzuführen. Jörg Döring hat den Pessimismus mit diesem Band der Werke widerlegt.“ Und selbst wenn es in der editorischen Notiz heißt: „Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich künftig vereinzelt noch weitere journalistische Texte Koeppens in den Zeitungsarchiven werden finden lassen.“2; so konnte die Vollständigkeit durch philologisch sorgfältigste Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen ermöglicht werden. Wird der reine Umfang des Bandes betrachtet so fällt auf, dass lediglich die Romanfragmente (Band 11) einen ähnlichen Umfang von Koeppens Primärtexten aufweisen.3
Es stellt sich die Frage, wie diese beiden Bände der Werkausgabe einzuordnen sind. Wie bereits oft erwähnt, blieb der große Roman aus. Koeppens (vermeintliches) Bestreben und die von Siegfried Unseld aufgebrachte Geduld sind bereits im veröffentlichten Briefwechsel der beiden nachlesbar.4 In der Werkausgabe zeigt sich durch die Bände Romanfragmente und Feuilletons nun wie umfangreich Koeppens schriftstellerisches Werk wirklich war. Ein nicht zu unterschätzender Teil wird jetzt durch sein journalistisches Frühwerk zugänglich. Es zeigt einen Autor, der durchaus fähig war unter Druck, der selbstverständlich in der Tagespresse dazu gehört, produktiv zu sein. Selbst wenn es sich hier um journalistische Texte, die sich faktualen kulturellen Entwicklungen widmen, handelt, sind diese für alle begeisterten Leser*innen von Koeppens fiktionalem Werk äußerst interessant. Wissenschaftlich ist dieses Frühwerk hinsichtlich Koeppens späterer modernistischen Stilistik zu untersuchen. Kann der Koeppen-Sound bereits in Ansätzen erkannt werden?
Und ähnlich interessant ist der Feuilleton-Band nicht nur für Koeppen-Begeisterte. Über die journalistischen Texte werden hier Teile eines Stimmungsbilds der Weimarer Republik und insbesondere des kulturellen Lebens im Berlin der beginnenden 1930er Jahre zum Leben erweckt, welches zusätzlich von (kultur-)historischem Interesse ist. Neben der zwischen 1928-1933 stetig erstarkenden NSDAP sind die welt- und nationalpolitischen Schwierigkeiten der Weimarer Republik in Koeppens journalistischem Werk nahezu ausgeblendet. Vielmehr erfährt die Leseinstanz viel über (zweitklassige) Theatervorführungen, zeitgenössische (teils nationalistische) Buchkritiken und die für Koeppen besonders relevanten Filmkritiken. Die gesammelten Feuilletons sind editorisch überschaubar einsortiert, in den Unterkapiteln nach Daten sortiert und als Gesamtwerk nummeriert. Selbstverständlich finden sich nach jedem abgedruckten Text philologische Angaben, Druckgeschichte und feinsäuberlichrecherchierte Anmerkungen, die den Kontext der jeweiligen Kritik abbilden. Das philologische Herz schlägt höher angesichts der großartigen Arbeit Jörg Dörings, die hier zu erwähnen ist, aber auch hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Expertise erwartbar war.
Der 13. Band der Werkausgabe ist in drei Abteilungen aufgeteilt. Beginnend mit Koeppens frühen Reportagen und Feuilletons, folgen seine Kritiken. Diese zweite Abteilung ist wiederum in drei Unterkategorien aufgelistet: Theater, Literatur und Film. Der Band schließt mit Anekdoten und Lokalberichten. Den ältesten Text verfasste Koeppen mit 16 Jahren: In der Greifswalder Zeitung beschwert er sich fast schon polemisch über die Schließung des Stadttheaters in den Sommermonaten (vgl. F, S. 129). Sein kulturinteressierter Charakter wird hier bereits deutlich, selbst wenn der Tonfall seiner Einsendung von einer jugendlichen Aufmüpfigkeit geprägt ist. Der wenig später verfasste Text Mode und Expressionismus, der als erster im 13. Band der Werkausgabe zu finden ist (vgl. F, S. 9), zeugt hingegen von einer Reife und Aussagekraft, die durchaus überrascht. Nicht nur der ästhetische Weitblick, welchen Koeppen hier preisgibt, zeigt seine Auseinandersetzung und Kritik mit dem expressionistischen Jahrzehnt, auch die Stilistik spricht für Koeppens kulturjournalistisches Talent, indem sachlich verargumentiert wird und zugleich eine metaphorische Schreibweise zu erkennen ist, die seine abstrakte Darstellung des Modernismus in die Lebensrealität (groß)städtischer Kulturentwicklung überführt und greifbar macht. Diese scharfsinnige Betrachtung des Kulturbetriebs zeugt von dem Übergang einer avantgardistischen Kunstform in eine popularisierte. Um mit Bourdieu zu sprechen, kritisiert Koeppen den Verlust symbolischen Kapitals für ökonomisches,5 wodurch nicht nur der modernistische Anspruch verloren ginge, sondern auch der ästhetische Wert:
„Durch Umwälzungen kamen viele zu Geld. Ohne jedes Verständnis kauften sie Kunst, - denn es gehört sich so. Natürlich kauften sie das Modernste. Schlau nützen Kunstspekulanten die Lage. Sie malten noch schiefere Häuser und schrieben noch wirrere Bücher – und die meisten Kunstsachverständigen beachteten den Expressionismus nicht mehr. Das ist ein Unrecht gegen die wirklichen Künstler. Man muß die Werke, die um der Mode willen entstanden, von denen scheiden, die entstehen mußten. Hier wird man viel ernstes Ringen und eine tiefe seelische Kunst finden.“ (F, S. 10).
Doch nicht nur Koeppens Frühwerk wird hier endlich zugänglich. Der von September 1930 bis Dezember 1933 im Berliner Börsen-Courier publizierende Koeppen kann nun anhand seiner veröffentlichten Feuilleton-Beiträge auch hinsichtlich der politischen Lage in der auslaufenden Weimarer Republik und seiner publizistischen Laufbahn unter dem Nazi-Regime detaillierter untersucht werden. Jörg Dörings Nachwort schätzt die innere Emigration Wolfgang Koeppens als in sich zurückgezogenes Schreiben: „[…] Koeppens Schreiben für die Zeitung im März 1933 [konnte] unter Umständen auch ganz selbstbezogen und -genügsam sein: buchstäblich ohne Rücksicht auf die ihm umgebenden politischen Umstände.“ (F, S. 654) Diese Einschätzung Dörings deckt sich mit den Ergebnissen seiner Dissertation6 und ist absolut Recht zu geben. Interessant ist auf metakritischer Ebene, dass die Tagespresse dies relativ undifferenziert einschätzt: Koeppens feuilletonistisches Werk sei „opportunistisch“7 oder zumindest „politisch biegsam“8. Immerhin räumt Thomas Blum ein, dass Jörg Döring im Kommentar einen Brief Koeppens von 1933 erwähnt, in welchem Koeppen schreibt: „Was ich hier mache, ist Dreck. Was ich machen will, ist mehr.“ (F, S. 666). Blum lässt diese Selbstreflexion Koeppens jedoch unkommentiert. Wenn jedoch schon auf Koeppens – durchaus kontrovers zu sehenden – letzten Monate im Berliner Börsen-Courier Bezug genommen wird, so sollte wenigstens aufgrund der vorliegenden Primärtexte eine Wertung dieser Biegsamkeit erfolgen. Jörg Döring schafft dies durch seine präzise Analyse im Kommentar: „Man spürt förmlich, wie unbefriedigend derlei opportunistisches Schreiben gewesen sein muss.“ (F, S. 662). Dem ist eindeutig zuzustimmen. Dass eine Anpassung von Koeppens Berichterstattung an die ideologischen Gegebenheiten notwendig war, um weiterarbeiten und auch finanziell überleben zu können, war durch die bereits erwähnte Monographie Jörg Dörings bereits bekannt. Der vorliegende Band der Werkausgabe legt vielmehr ein direktes Zeugnis ab und zeigt gleichzeitig, dass Koeppen kein radikal-nationalsozialistisches Gedankengut verfasste – sein opportunistisches Schreiben sollte demnach nicht ideologisch bewertet werden, sondern im Sinne existentieller Sorgen. Werden die wenigen (zehn an der Zahl) journalistischen Texte nach 1945 betrachtet, so sollte im gleichen Zuge mit seiner kurzen Phase des Opportunismus (die ja auch bereits 1933 endet) Koeppens Wertung des Dritten Reichs in unmittelbarer Nachkriegszeit 1947 betont werden. Beispielsweise: „Neben den deutschen Stimmen, die in der Vergangenheit zum Schweigen verurteilt waren, sind es die geistig Schaffenden anderer Länder, die nun wieder nach den Zeiten des Abgesperrtseins zum deutschen Menschen reden.“ (F, S. 429) „[…] die Zeitereignisse der letzten zwölf grauenvollen Jahre […]“ (F, S. 526). Gleichzeitig wird übersehen, dass Koeppen ebenfalls – wenn auch in verschwindend geringer Anzahl – in der Roten Fahne (dem damaligen Zentralorgan der KPD) publiziert hat. Hier geht es um keine Ehrenrettung oder Verharmlosung. Es soll lediglich darauf aufmerksam gemacht werden, dass eine differenzierte Betrachtung von Koeppens Rolle im beginnenden Dritten Reich notwendig für eine Bewertung ist. Die noch erscheinenden Bände der Werkausgabe zu Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch (noch in Planung) und den Drehbüchern (Erscheinungsdatum voraussichtlich Ende 2025) können diese Differenzierung noch erweitern. Nur so wird man Koeppen als Autor gerecht.
Unabhängig dieser Debatte zeigt sich in dem vorliegenden Band jedoch eine wahre Bandbreite an interessanten Zeitdokumenten zu Theater-, Literatur- und Filmrezensionen. Im Gegensatz zu den von Koeppen besprochenen Theateraufführungen „zweiten Grades“9 zeugen besonders die Filmkritiken von seinem cineastischen Enthusiasmus. Döring kommt hier zu dem Schluss, dass besonders seine Jugendlichkeit ihn dazu befähigte, diese „jüngste[…] (unbürgerliche[…])“ Kunst zu rezensieren (F, S. 631). Wolfgang Koeppens Feuilletons zeugen bereits von jener sprachlichen Finesse, für die sein späteres Romanwerk bekannt werden sollte. Dieser Band der Werkausgabe füllt (endlich) eine Lücke des koeppenschen Schreibens und ist nicht nur für die Literaturwissenschaft interessant. Auch interessierte Leser*innen werden hier fündig – ganz gleich, ob es sich um Koeppen-Fans, Feuilleton-Begeisterte oder Neugierige, die einen Einblick in das kulturelle Leben eines Berlins der Weimarer Republik erhalten möchten – handelt.
1 Vgl. Erhart, Walter: Wolfgang Koeppen. Das Scheitern moderner Literatur. Konstanz: Konstanz University Press 2012, S. 11-23.
2 Koeppen, Wolfgang: Feuilletons, Kritiken, Berichte (1923-1948). In: ders.: Werke, Band 13: Feuilletons, Kritiken, Berichte (1923-1948). Hrsg. v. Jörg Döring. Berlin: Suhrkamp 2024, S. 675-676. (Diese Ausgabe wird im Folgenden unter Verwendung der Sigle F und der jeweiligen Seitenangabe direkt im Text nachgewiesen.)
3 Dies entspricht dem Stand der Werkausgabe im Mai 2025, zu diesem Zeitpunkt liegen die Bände 3, 12, 14 und 15 noch nicht vor. Der 16. Band der Werkausgabe (Gespräche und Interviews) umfasst zwar ähnlich viele Seiten, kann aber im strengen Sinne nicht den Primärtexten zugerechnet werden.
4 Vgl. Estermann, Alfred/Schopf, Wolfgang (Hrsg.): „Ich bitte um ein Wort…“. Wolfgang Koeppen – Siegfried Unseld. Der Briefwechsel. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006.
5 Vgl. Bourdieu, Pierre: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Felds. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001, S. 227-235.
6 Vgl. Döring, Jörg: Ich stellte mich unter, ich machte mich klein. Wolfgang Koeppen 1933-1948. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003.
7 Blum, Thomas: Das natürliche warme Gefühl des Mannes. Im neuesten Band der Wolfgang-Koeppen-Werkausgabe sind erstmals sämtliche seiner Feuilletontexte versammelt. In: nd vom 21.03.2025, https://www.nd-aktuell.de/artikel/1189967.wolfgang-koeppen-das-natuerliche-warme-gefuehl-des-mannes.html, Datum des Zugriffs: 20.05.2025.
8 Schröder, Christian: Feuilletons von Koeppen. Das pralle Leben, ganz aus der Nähe. In: Tagesspiegel, Nr. 25855 vom 27.01.2025, S.29.
9 zitiert nach Hänztschel, Hiltrud/Häntzschel, Günter: „Ich wurde eine Romanfigur“. Wolfgang Koeppen 1906-1996. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006, S. 41.